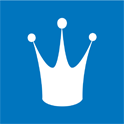Lena, 12 Jahre, aus Wien
*****
Hallo, ich bin Mary.
Ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen. Sie ist weder außergewöhnlich noch einzigartig, aber dennoch ist sie es wert, gehört zu werden.
Also, beginnen wir. Dazu müssen wir in der Zeit einige Jahre zurückgehen, genauer gesagt bis ins Jahr 1846. Denn in diesem Jahr wurde ich geboren.
Bei meiner Geburt herrschte in meiner Heimatstadt ein furchtbarer Krieg. Ehrlichgesagt weiß ich nicht mal, ob er noch immer stattfindet…aber schweifen wir nicht vom Thema ab. Wie gesagt gab es einen Krieg und meine Eltern wollten mit mir und meiner älteren Schwester fliehen. Wir waren nicht gerade wohlhabend, zwar waren wir nicht arm, aber es gab nicht viel Zeug, das wir mitnehmen hätten können. Dabei ging es eigentlich nicht darum, was zurückbleiben würde, sondern darum, ob wir schnell genug fliehen konnten, damit keiner von uns zurückblieb. Wir kamen nicht gerade gut aus unserer Stadt heraus, erzählte mir meine Schwester. Überall waren bewaffnete Soldaten.
Auch andere Familien waren verzweifelt und wollten fliehen, wie wir. Einigen gelang es, aber den meisten nicht.
Ich war noch ein Baby und bekam nicht viel mit, meine Schwester war allerdings schon fünf Jahre alt. Für sie war es eine harte Zeit. Sie verstand noch nicht, warum sie gehen mussten. Sie war noch viel zu jung, um so etwas durchleben zu müssen.
Meine Eltern bemühten sich, das Ganze schönzureden. Aber wie könnte man einen Krieg schönreden? Wie kann man es schönreden, dass Menschen umgebracht werden, dass Kinder ihre Eltern verlieren oder Eltern ihre Kinder? Und das alles nur, weil manche Leute eine „Art Menschen“ oder eine Religion nicht akzeptierten…
Aber genug davon. Auf jeden Fall waren wir tatsächlich eine der wenigen Familien, die es geschafft haben, zu fliehen. Oder anders gesagt: Frei zu sein. Obwohl … kann man das so sagen? Wir waren frei, aber in Gedanken nicht frei vom Krieg. Lebten unsere Großeltern oder Freunde noch? Hatten sie es geschafft, zu entkommen?
Außerdem gab es dringende Probleme bei unserer Flucht. Wo sollten wir unterkommen? Wir hatten nur das Wichtigste dabei, und zwar vor allem Proviant und Wasser. Viel mehr war nicht möglich gewesen, da wir alles tragen mussten. Ohne Ziel wollten alle weg. Einfach nur weg!
Wir marschierten tagelang. Nein, wochenlang. Wir marschierten immer weiter, um eine Stadt zu erreichen, in der wir aufgenommen werden konnten. Alle waren längst erschöpft und wollten aufgeben, aber mein Vater wollte unbedingt seine Familie retten. Er brachte uns dazu, weiterzugehen, und sagte uns, es würde alles gut werden. Aber alle wussten, dass auch er Angst hatte.
Als wir endlich bei einer Stadt ankamen, waren unsere Vorräte knapp und alle waren erschöpft. Das war unsere Hoffnung, die Hoffnung auf ein neues Leben.
Mein Vater klopfte an jede Tür und bat um Hilfe, doch die meisten sahen uns komisch an und schlugen die Türe zu. Als wären wir Fremde, von einem anderen Planeten. Dabei waren wir doch nur Menschen.
Als wir weitergehen wollten, sprach uns eine Frau mit mitfühlenden braunen Augen auf der Straße an. Sie bot uns etwas zu essen an. Wir folgten ihr zu einem Haus und sie öffnete die Tür und forderte uns auf, hereinzukommen. Wir setzten uns an den Tisch in der Küche und bekamen Fleisch und Obst, um uns etwas zu stärken. Mein Vater bedankte sich tausendmal.
Auf einmal kam ein Mann aus einem anderen Zimmer und schrie auf uns ein, was wir hier machen würden, dass wir hier nichts zu suchen hätten, dass es nicht unser Land wäre. Er scheuchte uns hinaus. Vor die Tür.
Unsere ganze Hoffnung war wie ausgelöscht. Wir wollten gehen, da öffnete sich die Tür einen Spalt und die Frau blickte wieder heraus. Sie sagte, sie könne die zwei Kinder, also meine Schwester und mich, aufnehmen und zu jemandem bringen, der sich gut um uns kümmern würde. Meiner Mutter und meinem Vater brach es das Herz, aber beide wussten, dass sie sich nicht ausreichend um uns kümmern könnten. Nicht in dieser Lage. Die Frau, die uns geholfen hat, hat mir und meiner Schwester erzählt, dass unsere Eltern krank waren. Sie meinte, sie erinnert sich genau an ihre abgemagerten, blassen Gesichter und an den schlimmen Husten, der beide befallen hatte. Sie denkt, dass sie uns auch deshalb hergaben: Weil sie wussten, dass sie vielleicht bald sterben würden.
Also gaben sie uns der Frau, voller Vertrauen.
Die Frau brachte uns zu einer Ms. Galcy. Diese war selbst aus dem Krieg geflüchtet. Sie hatte keine Kinder und nahm uns deshalb gerne auf.
Über das Schicksal unserer Eltern wissen wir nichts. Meine Schwester und ich hatten eine sehr enge Bindung zu Ms. Galcy, aber trotzdem konnten wir sie nicht „Mutter“ nennen. Meine Schwester erzählte mir jeden Abend vor dem Einschlafen von meinen Eltern. Sie sagt, dass sie uns bestimmt gesucht und zu sich geholt hätten, wenn sie nicht krank gewesen wären. Wir denken also beide, dass sie schon lange tot sind.
Ich frage mich trotzdem oft, ob sie mich wohl geliebt hätten. Ob sie den Mensch mögen würden, der ich geworden bin. Diese Gedanken machen mich wütend und traurig. Meine Eltern mussten sterben, weil Menschen einen sinnlosen Krieg führen mussten, und sie haben mich nie kennengelernt.
Die Jahre vergingen und wir wurden älter. Ms. Galcy war immer für uns da und ermöglichte uns trotz unserer Vergangenheit noch eine schöne Kindheit.
Jetzt sitze ich hier und schreibe meine Geschichte auf. Ich weiß nicht, ob die Menschen sie lesen werden. Aber ich wollte meine Eltern nicht vergessen. Sie sind Teil meiner Geschichte, auch wenn ich keine eigenen Erinnerungen an sie habe.
Ich hoffe, dieser Krieg war der letzte und kein Kind muss mehr durchmachen, was ich und meine Schwester durchmachen mussten – getrennt werden von den Eltern, entwurzelt und in eine fremde Umgebung geworfen. Natürlich werde ich das nicht beeinflussen können. Aber wer weiß? Vielleicht bringe ich manche Menschen mit meiner Geschichte zum Nachdenken. Denn ich hoffe, sie werden alles tun, damit Kindern und Erwachsenen nicht das passiert, was uns passiert ist.
Mary R., 1870.